Gesundheitswesen
Klinik kämpft gegen Minus: „Die Frage ist, wie lange wir das durchhalten“
Neubrandenburg / Lesedauer: 6 min

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum ist das größte Krankenhaus im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Die schwierige Wirtschaftslage verhindert überfällige Investitionen, verschärft personellen Mangel, ächzt unter gesundheitspolitischen Reglementierungen. Im Gespräch mit Susanne Schulz nehmen Geschäftsführerin Gudrun Kappich, der Ärztliche Direktor Prof. Jens-Peter Keil und Renate Krajewski, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, die Politik in die Pflicht für medizinische Daseinsvorsorge.
Als „historischen Tiefpunkt“ beschreibt die Deutsche Krankenhausgesellschaft die gegenwärtige Situation der Krankenhäuser in deutschlandweitem Maßstab, angesichts negativer Jahresergebnisse in vier von fünf Häusern und noch schlechterer Prognosen für 2025. Wie steht es um das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum?
Kappich: In dieses Stimmungsbild reihen wir uns ein. Nicht so dramatisch wie bei vielen kleineren Krankenhäusern, aber was nützt das schon? Die gesetzliche Pflicht des Staates und der Krankenkassen, medizinische Versorgung auskömmlich auszustatten, wird von beiden Seiten nicht mehr erfüllt. Stattdessen sind Forderungen und Reglementierungen der Wirklichkeit immer einen Schritt voraus. Ebenso müssten wir personell in die Lage versetzt werden, unseren Versorgungsauftrag zu erfüllen, aber auch das ist nicht der Fall. Deshalb sind wir gezwungen, einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der ein Minus ausweist.
Keil: Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser um uns herum ist nicht besser. Ich sehe aber auch keinerlei politischen Willen, das zu ändern.
Wodurch hat sich die Situation so drastisch verschärft?
Kappich: Explodierende Energiekosten, Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Material, gestiegene Fahrkosten bei allen, die uns beliefern, weil auch Kraftstoff so viel teuer geworden ist – all das bringt uns Mehrkosten von zwölf Prozent. Wir dürfen aber unsere Preise nur um vier Prozent anheben. Zugleich liegen die Patientenzahlen weiterhin unter dem Vor-Corona-Stand von 2019. Mit fünf Prozent weniger stehen wir zwar noch gut da. Bei manchen Häusern sind es 30 bis 50 Prozent, im bundesweiten Durchschnitt 18. Aber auch fünf Prozent bedeuten 14 Millionen Euro weniger in der Kasse. Die Frage ist, wie lange wir das durchhalten.
An welchen Stellschrauben können Sie drehen, um diese Entwicklung aufzufangen?
Kappich: Personalabbau oder andere Einsparungen können nicht unser Weg sein. Wir wollen unsere Leute halten.
Krajewski: Und auch weiterhin Personal einstellen, denn wir haben im Blick, dass die Generation der Babyboomer uns nach und nach verlässt.
Kappich: Etwas Entlastung erhoffen wir uns von der Kurzliegerstation, die wir demnächst eröffnen. Sie ist fachübergreifend gedacht für Patienten, die nur wenige Tage hier sind, sodass sie an den Wochenenden nicht belegt ist. Unter dieser Maßgabe haben wir auch schon einige Bewerbungen von Pflegekräften.
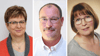

Wie steht es insgesamt um die personelle Ausstattung?
Keil: Wir brauchen deutlich mehr Köpfe, und die wollen vernünftig bezahlt werden. Wir verlieren auch Spezialisten, die wir über Jahre aufgebaut haben, an andere Krankenhäuser. Nachdem in Deutschland Medizinstudienplätze eingestampft wurden, sind inzwischen 45 Prozent der ärztlichen Mitarbeiter ausländischer Herkunft, aus mehr als 50 Nationen. Eigentlich eine Frechheit, dass sich das reiche Deutschland aus allen Ecken der Welt bedient.
Kappich: Aus Überzeugung tun wir das aber nur über seriöse Vereinbarungen mit Herkunftsländern, die nicht selbst Mangel leiden, in der Pflege zum Beispiel mit Beschäftigten und Auszubildenden aus Indien und in der Medizin mit Ärzten aus Mexiko. Insgesamt ist der Personalbestand in den vergangenen 20 Jahren um ein Drittel gewachsen, auf rund 3000 Beschäftigte an unseren Standorten in Neubrandenburg, Altentreptow, Malchin und Neustrelitz. Aber das reicht bei jährlich mehr als 70.000 Patienten trotzdem kaum für vorgeschriebene Pflegepersonal-Untergrenzen oder die Forderung nach einer bestimmten Anzahl von Fachärzten bestimmter Qualifikationen.
Kämpfen müssen Sie auch um überfällige Investitionen – vor allem für die Erweiterung der Zentralen Notaufnahme, die seit Jahren ganz oben auf Ihrer Dringlichkeitsliste steht. Den nötigen Eigenanteil von etwa zehn Millionen Euro allerdings kann das Klinikum, wie Sie bereits deutlich machten, schwerlich aufbringen.
Keil: Wie kann denn auch bitte ein Krankenhaus Eigenmittel haben? Das wären ja Beiträge der Krankenkassen, die nicht in die Versorgung der Patienten fließen.
Kappich: Als freigemeinnütziger Träger stehen wir glücklicherweise nicht unter dem Rendite-Druck großer privater Konzerne. Dennoch wird es immer enger. Während schon an mehreren Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern neue Notaufnahmen gebaut wurden, haben wir keinerlei Zusagen vom Ministerium und den Krankenkassen, die es uns ermöglichen würden, mit dem Neubau zu beginnen.
Krajewski: Und je länger sich dieser Kampf hinzieht, desto mehr steigen die Kosten weiter, sodass dieselbe Summe immer weniger wert ist.
So wie Sie es auch bei der Sanierung von Haus R erleben, für die Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese voriges Jahr einen „Nachschlag“ von 1,8 Millionen Euro mitbrachte – ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein?
Kappich: Es ist gut, dass Frau Drese hier war. Aber auch das wird nicht reichen, um Haus R fertigzustellen. Auch die geplante Erweiterung der Psychiatrie, für die dringender Bedarf besteht, können wir mangels ausreichender Eigenmittel nicht realisieren. Diese Eigenmittel stecken wir nun in den laufenden Betrieb. Fördermittel allein sind fast nie auskömmlich. Neu ist aber, dass wir uns jetzt bei jeder Sanierung fragen müssen, ob wir das Geld auch nach Zahlung aller laufenden Kosten übrig haben.
Weitere „Baustellen“ sind gesundheitspolitischer Natur, wie etwa Mindestmengenregelungen für diverse Fachgebiete. Inwieweit können Kooperationen wie der Klinikverbund der Seenplatte oder das gemeinsame Lungenzentrum mit dem Müritz-Klinikum und der Klinik Amsee die Situation entspannen?
Keil: In der thoraxchirurgischen Behandlung des Lungenkarzinoms konnte durch die Zusammenarbeit im Lungenzentrum die Mindestmenge erfüllt werden, die für die weitere Leistungserbringung nachzuweisen ist. Aber auch Kooperationen werden reglementiert. Ebenso in der Telemedizin, die wir angeblich stärken wollen. Gleichzeitig aber wird sie durch die Vorgabe maximaler Entfernungen zwischen den Beteiligten behindert.
Kappich: Im Klinikverbund der Seenplatte gibt es eine gute Zusammenarbeit, wir haben Kooperationsvereinbarungen mit allen umliegenden Krankenhäusern. Von den Fachabteilungen unseres Hauses stelle ich definitiv keine infrage. Wenn nur eine wegbräche, hätte das Auswirkungen auch für viele Komplementärbereiche. Besorgt sind wir, dass viele Menschen gar nicht ahnen, wie es um die Krankenhäuser steht. Wenn im Bundestag nur ein einziger SPD-Abgeordneter gegen die sogenannte Krankenhausreform stimmt und es auf eine Petition mit mehr als 100.000 Unterschriften für unser Perinatalzentrum-Level1 bis heute keine abschließende Antwort auf dem Gesundheitsministerium gibt, scheint das Thema niemanden mehr zu interessieren.
Was erwarten Sie daher von der Neuwahl des Bundestags und der künftigen Politik, von der wiederum die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine „Reform der Reform“, aber auch Investitionsförderung und Inflationsausgleich fordert?
Keil: Letztlich zielt die Reform auf Sparen. Aber wir machen hier keine Geschäfte, sondern wir sichern die medizinische Versorgung der Menschen in der Region – und dafür brauchen wir eine auskömmliche Finanzierung.
Kappich: Womöglich heißt der Gesundheitsminister nach der Wahl wieder Karl Lauterbach, und den ficht ja nichts an. Wir halten die Reform für gefährlich, weil sie sehr theoretisch gedacht ist – nämlich aus der Perspektive von Großstädten und daher völlig ungeeignet für ein Flächenland, weit an den Erfordernissen der Bevölkerung vorbei. Aber wir werden nicht nachlassen, die Politik an ihre Verantwortung für die Daseinsvorsorge zu erinnern.






